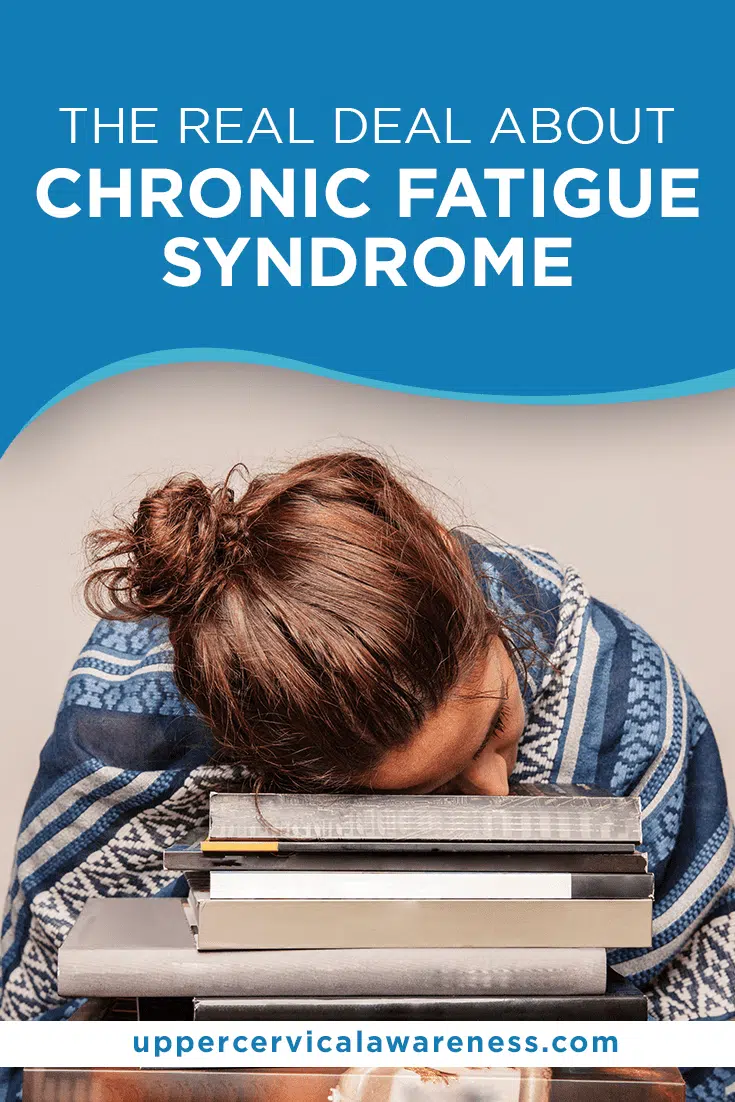Als erfahrener Gesundheitsexperte, der über drei Jahrzehnte in der Medizinbranche tätig war: Das chronische Erschöpfungssyndrom gehört zu den am meisten missverstandenen und unterschätzten Erkrankungen unserer Zeit. In meiner langjährigen Praxis habe ich miterlebt, wie sich das Verständnis dieser komplexen Krankheit grundlegend gewandelt hat – von einer einst als “eingebildet” abgetanen Befindlichkeitsstörung zu einer heute als schwere neuroimmunologische Erkrankung anerkannten Multisystemerkrankung.
Definition und Grundlagen des chronischen Erschöpfungssyndroms
Was wir heute als chronisches Erschöpfungssyndrom oder ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) bezeichnen, ist weit mehr als gewöhnliche Müdigkeit. Hier geht es um eine schwerwiegende neuroimmunologische Erkrankung, die das Nerven- und Immunsystem betrifft und zu einer dramatischen Einschränkung der Lebensqualität führt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft ME/CFS bereits seit 1969 als neurologische Erkrankung ein und führt sie im ICD-10 unter der Kennziffer G93.3.
In Deutschland sind aktuellen Schätzungen zufolge etwa 650.000 Menschen an ME/CFS erkrankt. Diese Zahl hat sich durch die COVID-19-Pandemie drastisch erhöht – vor der Pandemie waren es etwa 250.000 Betroffene, darunter 40.000 Kinder. Die Prävalenz liegt bei etwa 0,1 bis 0,7 Prozent der Bevölkerung, wobei Frauen etwa doppel so häufig betroffen sind wie Männer.
Die komplexe Symptomatik des chronischen Erschöpfungssyndroms
Post-Exertionelle Malaise als Leitsymptom
Das zentrale und charakteristische Merkmal von ME/CFS ist die sogenannte Post-Exertionelle Malaise (PEM). Aus meiner Erfahrung ist dies das Symptom, das ME/CFS von anderen Erschöpfungszuständen unterscheidet. PEM bezeichnet eine unverhältnismäßige Verschlechterung aller Symptome nach bereits geringster körperlicher oder geistiger Anstrengung. Diese Verschlechterung tritt oft zeitversetzt auf – manchmal erst Stunden oder sogar Tage nach der auslösenden Aktivität.
Was für gesunde Menschen völlig normale Tätigkeiten sind – ein kurzer Spaziergang, ein Gespräch oder sogar eine Dusche –, können bei ME/CFS-Betroffenen einen sogenannten “Crash” auslösen. Diese Crashes können Tage, Wochen oder sogar Monate andauern und die Betroffenen in einen Zustand versetzen, der sie völlig handlungsunfähig macht.
Fatigue: Mehr als normale Müdigkeit
Die krankhafte Erschöpfung bei ME/CFS unterscheidet sich fundamental von normaler Müdigkeit. Betroffene beschreiben sie als “Erschöpfung, Schwäche, Mangel an Energie, die Unfähigkeit für längere Zeit zu stehen oder einige Häuserblocks weit zu gehen”. Diese Fatigue lässt sich weder durch Schlaf noch durch Ruhe bessern. Selbst nach stundenlangem Schlaf wachen Betroffene oft völlig erschöpft auf.
Neurologische und kognitive Beeinträchtigungen
Ein besonders belastender Aspekt von ME/CFS sind die neurologischen Symptome, die oft als “Brain Fog” oder “Gehirnnebel” bezeichnet werden. Betroffene leiden unter Konzentrationsstörungen, Gedächtnisproblemen, Wortfindungsstörungen und einer generellen Verlangsamung der Denkprozesse. Diese kognitiven Einschränkungen können so schwerwiegend sein, dass einfachste geistige Aufgaben unmöglich werden.
Weitere Begleitsymptome
Das Spektrum der ME/CFS-Symptome ist außerordentlich breit und umfasst:
Schlafstörungen: Nicht erholsamer Schlaf, Ein- und Durchschlafstörungen, gestörter Tag-Nacht-Rhythmus
Schmerzen: Muskel- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, die oft als neu aufgetreten beschrieben werden
Autonome Dysfunktion: Herzrasen, niedriger Blutdruck, Schwindel, Übelkeit, Temperaturregulationsstörungen
Immunologische Symptome: Empfindliche Lymphknoten, wiederkehrende Halsschmerzen, grippe-ähnliche Symptome, erhöhte Infektanfälligkeit
Sinnesempfindlichkeiten: Überempfindlichkeit gegenüber Licht, Geräuschen, Berührungen und Gerüchen
Ursachen und Entstehungsmechanismen
Die exakten Ursachen von ME/CFS sind noch nicht vollständig verstanden, aber die Forschung der letzten Jahre hat wichtige Erkenntnisse gebracht. Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung mit schweren Störungen des Energiestoffwechsels in den Mitochondrien handelt. Zusätzlich wurden Veränderungen im Hormonhaushalt und im Nervensystem festgestellt.
Virale Auslöser
In meiner Praxis habe ich beobachtet, dass ME/CFS häufig nach viralen Infektionen auftritt. Die häufigsten Auslöser sind:
- SARS-CoV-2 (COVID-19)
- Epstein-Barr-Virus (Pfeiffersches Drüsenfieber)
- Influenza (echte Grippe)
- Enteroviren
- Dengue-Fieber
Besonders seit der COVID-19-Pandemie ist ein deutlicher Anstieg der ME/CFS-Fälle zu verzeichnen. Etwa die Hälfte der Long-COVID-Patienten erfüllt die Diagnosekriterien für ME/CFS.
Prädisponierende Faktoren
Zwillingsstudien deuten auf eine genetische Anfälligkeit für ME/CFS hin. Zusätzlich scheinen bestimmte Lebensumstände die Entstehung zu begünstigen:
- Stress und hohe körperliche Aktivität vor dem auslösenden Infekt
- Psychische Belastungen
- Operationen oder Unfälle
- Verletzungen im Bereich des Schädels und der Halswirbelsäule
Diagnoseverfahren und Herausforderungen
Diagnostische Kriterien
Die Diagnose von ME/CFS basiert auf klinischen Kriterien, da bislang keine praxistauglichen Biomarker zur Verfügung stehen. Die am häufigsten verwendeten Diagnosesysteme sind:
Kanadische Konsenskriterien (CCC): Diese erfordern das Vorliegen von Post-Exertioneller Malaise, Fatigue, Schlafstörungen und Schmerzen, sowie mindestens zwei neurologische Manifestationen und Symptome aus mindestens zwei weiteren Kategorien. Die Symptome müssen mindestens sechs Monate bestehen.
Internationale Konsenskriterien (ICC): Diese fokussieren stärker auf die Post-Exertionelle Neuroimmune Erschöpfung (PENE) als Kardinalsymptom und erfordern keine Mindestdauer von sechs Monaten.
IOM-Kriterien: Entwickelt vom US-amerikanischen Institute of Medicine für Screening und Erstdiagnose.
Diagnostische Herausforderungen
Aus meiner Erfahrung ist die Diagnosestellung eine der größten Herausforderungen bei ME/CFS. Studien zeigen, dass bis zu 90 Prozent der Betroffenen nicht oder fehldiagnostiziert sind. Bis zur korrekten Diagnose vergehen oft fünf bis zehn Jahre. Dies liegt hauptsächlich daran, dass:
- Viele Ärzte nicht ausreichend über ME/CFS informiert sind
- Die Symptome denen anderer Erkrankungen ähneln können
- Routine-Blutuntersuchungen oft keine Auffälligkeiten zeigen
- Es nur wenige spezialisierte ME/CFS-Ambulanzen gibt
Erforderliche Untersuchungen
Bei Verdacht auf ME/CFS sind umfassende Untersuchungen zum Ausschluss anderer Erkrankungen erforderlich. Dazu gehören:
- Ausführliche Anamnese und klinische Untersuchung
- Blutuntersuchungen (Differentialblutbild, CRP, Ferritin, Schilddrüsenwerte, Immunglobuline)
- Ausschluss von Schilddrüsen-, Herz- und Lebererkrankungen
- Ausschluss von Anämie, Diabetes und neurologischen Erkrankungen
- Tests auf Infektionskrankheiten wie Borreliose oder chronische Hepatitis
Behandlungsansätze und Therapieoptionen
Pacing als Grundpfeiler der Behandlung
Da ME/CFS bislang nicht heilbar ist, konzentriert sich die Behandlung auf Symptomlinderung und Vermeidung einer Verschlechterung. Der wichtigste Baustein ist das sogenannte Pacing oder Energiemanagement.
Pacing bedeutet, die eigenen Aktivitäten streng innerhalb der individuellen Energiegrenzen zu halten. Das Ziel ist es, Post-Exertionelle Malaise zu vermeiden und das Risiko von Crashes zu minimieren. Aus meiner Beratungspraxis weiß ich, dass Pacing eine Kunst ist, die Betroffene erst erlernen müssen. Es geht darum:
- Die eigenen Energiegrenzen genau zu erkennen
- Aktivitäten in kleine, bewältigbare Einheiten aufzuteilen
- Regelmäßige Pausen einzuplanen
- Auf die ersten Warnsignale des Körpers zu hören
Die Löffel-Theorie hat sich als hilfreiches Modell erwiesen: Betroffene stellen sich vor, dass ihnen täglich nur eine begrenzte Anzahl “Löffel” als Energie zur Verfügung steht, die sie bewusst einteilen müssen.
Medikamentöse Behandlungsoptionen
Obwohl keine spezifischen Medikamente für ME/CFS zugelassen sind, können verschiedene “Off-Label”-Therapien symptomatisch helfen:
- Mestinon (Pyridostigmin): Kann bei orthostatischer Intoleranz hilfreich sein
- LDN (Low Dose Naltrexon): Wird zur Immunmodulation eingesetzt
- N-Acetylcystein: Unterstützt die Mitochondrienfunktion
- Schmerzmittel: Bei Muskel- und Kopfschmerzen
- Antidepressiva: Nur bei begleitender Depression
Supportive Therapiemaßnahmen
Weitere wichtige Behandlungsbausteine sind:
Schlafhygiene: Regelmäßige Schlafzeiten, ruhige Schlafumgebung
Entspannungsverfahren: Autogenes Training, Meditation, Atemübungen
Ernährungsberatung: Besonders bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Psychotherapeutische Unterstützung: Hilft beim Umgang mit den emotionalen Belastungen der Erkrankung
Physiotherapie: Sehr vorsichtig dosiert und nur bei stabilen Patienten
Schweregrade und Prognose
ME/CFS wird in vier Schweregrade eingeteilt:
Leichte Form
Betroffene sind eingeschränkt und verzichten oft zugunsten ihrer Arbeit auf Freizeitaktivitäten. Das Aktivitätsniveau ist um etwa die Hälfte reduziert.
Moderate Form
Die meisten Betroffenen können nicht mehr arbeiten. Sie sind stark eingeschränkt und ihre Symptome schwanken oft erheblich.
Schwere Form
Nur minimale Aufgaben wie Zähneputzen sind möglich. Betroffene benötigen Unterstützung beim Duschen und Kochen, sind oft auf den Rollstuhl angewiesen und ihr Leben spielt sich meist im Haus ab.
Sehr schwere Form
Betroffene sind bettlägerig, oft nicht mehr in der Lage zu sprechen oder Licht zu tolerieren. Manche müssen künstlich ernährt werden.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen
Die volkswirtschaftlichen Kosten von ME/CFS sind beträchtlich. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Long COVID und ME/CFS 2024 in Deutschland etwa 63 Milliarden Euro an gesellschaftlichen Kosten verursacht haben. Für den Zeitraum 2020 bis 2024 werden die kumulierten Gesamtkosten auf über 250 Milliarden Euro geschätzt.
Diese enormen Kosten entstehen durch:
- Produktivitätsverluste durch Arbeitsunfähigkeit
- Behandlungskosten
- Pflegekosten
- Krankengeld und Frühverrentung
Forschung und Zukunftsperspektiven
Die ME/CFS-Forschung in Deutschland hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, hauptsächlich durch die Arbeit der Charité Berlin unter Leitung von Professor Carmen Scheibenbogen. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert derzeit verschiedene Forschungsprojekte mit mehreren Millionen Euro.
Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind:
- Untersuchung der Gefäßprobleme und Durchblutungsstörungen
- Entwicklung von Biomarkern für die Diagnostik
- Erforschung neuer Therapieansätze
- Aufbau einer nationalen ME/CFS-Registry und Biobank
Häufige Fragen zum chronischen Erschöpfungssyndrom
Ist ME/CFS eine psychische Erkrankung?
Nein, ME/CFS ist definitiv keine psychische Erkrankung, obwohl es früher fälschlicherweise oft so eingestuft wurde. Die WHO klassifiziert ME/CFS seit 1969 als neurologische Erkrankung. Es handelt sich um eine schwere neuroimmunologische Multisystemerkrankung mit messbaren körperlichen Veränderungen.
Können sich ME/CFS-Patienten durch Sport bessern?
Nein, das ist ein gefährlicher Mythos. Generalisierte Aktivitäts- oder Trainingsprogramme können bei ME/CFS die Symptomatik unumkehrbar verschlechtern. Dies ist ein fundamentaler Unterschied zu anderen Erschöpfungssyndromen. Sport und erhöhte Aktivität können bei ME/CFS zu schweren Verschlechterungen führen.
Wie wird ME/CFS diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt anhand klinischer Kriterien, da es noch keine etablierten Biomarker gibt. Ärzte verwenden standardisierte Kriterienkataloge wie die Kanadischen Konsenskriterien und müssen andere Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen ausschließen. Eine gründliche Anamnese und verschiedene Blutuntersuchungen sind erforderlich.
Ist ME/CFS heilbar?
Derzeit gibt es keine Heilung für ME/CFS. Die Behandlung konzentriert sich auf Symptomlinderung, Vermeidung von Verschlechterungen und Verbesserung der Lebensqualität durch Pacing und supportive Maßnahmen. Einige Patienten erleben Verbesserungen, aber vollständige Heilungen sind selten.
Was ist Post-Exertionelle Malaise (PEM)?
PEM ist das charakteristische Hauptsymptom von ME/CFS. Es beschreibt eine unverhältnismäßige Verschlechterung aller Symptome nach bereits geringster körperlicher oder geistiger Anstrengung. Diese Verschlechterung tritt oft zeitversetzt auf und kann Stunden, Tage oder Wochen andauern.
Können Kinder und Jugendliche ME/CFS bekommen?
Ja, ME/CFS kann in jedem Lebensalter auftreten, auch bei Kindern und Jugendlichen. In Deutschland sind schätzungsweise 40.000 Kinder betroffen. Bei Kindern gelten teilweise andere Diagnosekriterien (drei statt sechs Monate Symptomdauer).
Welche Rolle spielt COVID-19 bei ME/CFS?
COVID-19 hat die Zahl der ME/CFS-Fälle drastisch erhöht. Etwa die Hälfte der Long-COVID-Patienten erfüllt die Diagnosekriterien für ME/CFS. Die Pandemie hat das Bewusstsein für ME/CFS geschärft und zu mehr Forschung geführt.
Was ist Pacing und wie funktioniert es?
Pacing ist die wichtigste Behandlungsstrategie bei ME/CFS. Es bedeutet, Aktivitäten streng innerhalb der individuellen Energiegrenzen zu halten, um PEM zu vermeiden. Betroffene lernen, ihre Energie bewusst einzuteilen und auf frühe Warnsignale ihres Körpers zu hören.
Wie häufig ist ME/CFS?
ME/CFS betrifft etwa 0,1 bis 0,7 Prozent der Bevölkerung. In Deutschland sind aktuell etwa 650.000 Menschen betroffen, vor der Pandemie waren es 250.000. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig wie Männer.
Können ME/CFS-Patienten arbeiten?
Das hängt vom Schweregrad ab. Viele ME/CFS-Patienten können nicht mehr arbeiten. Studien zeigen, dass etwa 75 Prozent der Betroffenen arbeitsunfähig sind. Ein Viertel ist an Haus oder Bett gebunden und häufig pflegebedürftig.
Was sind typische Begleitsymptome von ME/CFS?
Neben PEM und Fatigue treten häufig auf: nicht erholsamer Schlaf, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen (“Brain Fog”), Muskel- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Überempfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen, autonome Dysfunktion mit Herzrasen und Schwindel.
Welche Ärzte behandeln ME/CFS?
Es gibt nur wenige auf ME/CFS spezialisierte Ärzte. In Deutschland sind hauptsächlich die Charité Berlin und die Klinik rechts der Isar in München auf ME/CFS spezialisiert. Oft müssen Hausärzte die Betreuung übernehmen, da spezialisierte Ambulanzen fehlen.
Kann man ME/CFS vorbeugen?
Eine direkte Prävention ist nicht möglich, da die genauen Ursachen nicht vollständig bekannt sind. Allgemein kann ein gesunder Lebensstil mit ausreichend Schlaf, Stressvermeidung und einem starken Immunsystem das Risiko für virale Infektionen reduzieren, die ME/CFS auslösen können.
Welche Rolle spielen die Mitochondrien bei ME/CFS?
Aktuelle Forschungen zeigen, dass bei ME/CFS die Mitochondrien – die “Kraftwerke” der Zellen – beeinträchtigt sind. Es liegt eine schwere Störung des Energiestoffwechsels vor, die zu der charakteristischen Erschöpfung und Belastungsintoleranz beiträgt.
Gibt es Selbsthilfegruppen für ME/CFS-Betroffene?
Ja, es gibt mehrere Patientenorganisationen in Deutschland, wie Fatigatio e.V. und die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS. Diese bieten Informationen, Beratung und den Austausch mit anderen Betroffenen. Viele Regionalgruppen bieten sowohl Präsenz- als auch Online-Meetings an.
Welche Forschungsfortschritte gibt es bei ME/CFS?
Die Forschung hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, besonders in Deutschland. Aktuelle Projekte untersuchen Gefäßprobleme, entwickeln Biomarker und testen neue Therapieansätze. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert mehrere Millionen schwere Forschungsprojekte.